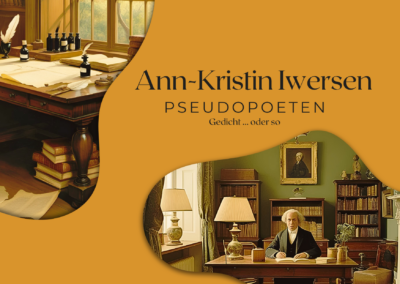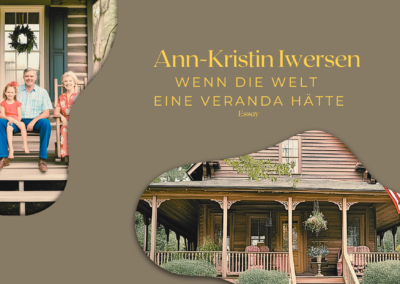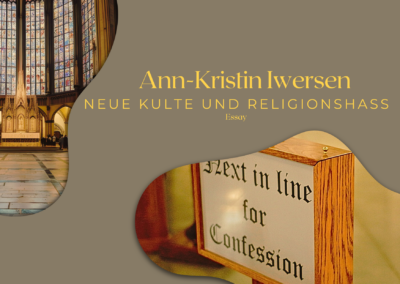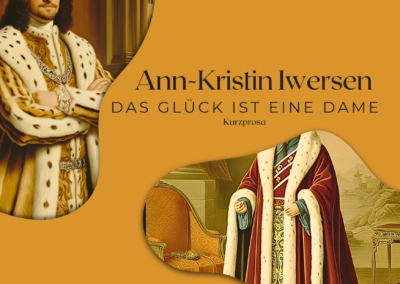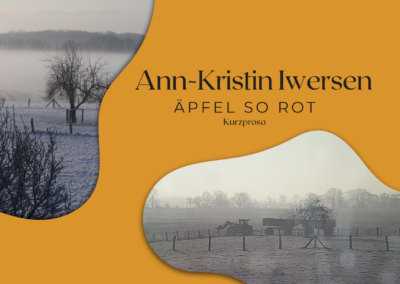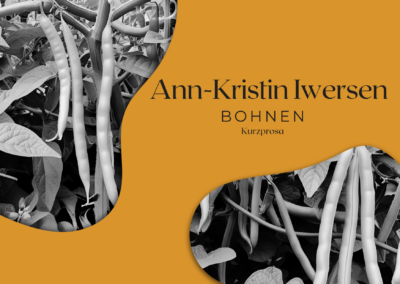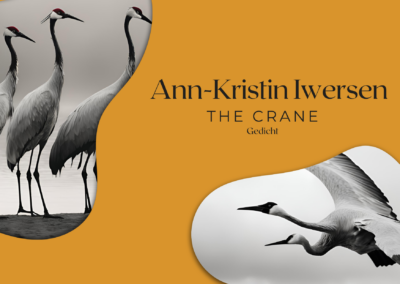Kreatives Schreiben, Wortkunst, Selfpublisher – was und warum?
Creative Writing – kreatives Schreiben als „Literatur schreiben“
„Kreatives Schreiben“ – da fängt es schon an. Dieser Begriff ist an und für sich ja bereits mehr als schwammig. Im angelsächsischen meint „creative writing“ meist Unterricht im Schreiben literarischer Texte. In Deutschland sind damit aber auch oft therapeutische Anwendungen des geschriebenen Wortes gemeint. Wenn ich es nicht ausdrücklich anders sage, dann meine ich mit „kreativem Schreiben“ immer „Literatur schreiben“. Aber auch auf kreatives Schreiben zu therapeutischen und anderen Zwecken, sowie auf verwandte Kunstformen wie Wortkunst will ich an dieser Stelle kurz eingehen.
Auch, wenn ich hier auf diese verschiedenen Formen eingehen möchte: Das, was mich eigentlich interessiert, ist das Schreiben von Literatur – wenn auch in so ziemlich allen ihren Formen. Zwar schreibe ich durchaus auch Sachbücher; doch diese sind nicht Gegenstand dieser Website und sie sind nicht ohne Grund unter einem Pseudonym veröffentlicht. Ich möchte diese beiden Aspekte nicht vermengen.
Literatur schreiben – ein schweres Los
Literatur zu schreiben, war vermutlich immer schon ein schweres Los. Schwerer als das Schreiben war aber immer schon das Verkaufen. Wer könnte davon nicht ein Lied singen! Nicht umsonst haben sich im Laufe des 20. Jahrhunderts darum ganze Industrien entwickelt, die helfen sollen: Literaturinstitute, an denen man literarisches Schreiben lernen kann; Fernstudium „Kreatives Schreiben“; Online-Kurse zum kreativen Schreiben; Kurse zum Roman-Schreiben … die Liste findet kein Ende. Und dann haben wir noch nicht die Agenten genannt, die auch irgendwann Verbreitung fanden, und nun in ihrem gesamten unnötigen Dasein wie die Wegelagerer ebenfalls ihr Stück vom Kuchen fordern. Alle diese Institutionen, Personenkreise und Kurse haben vor allem eines gemeinsam: Sie kosten Geld.
Bitte keine „Schreib-dein-Buch“-Kurse besuchen…
Und mit Ausnahme von „echten“ Literaturinstituten, die mit Verbindungen zu den entsprechenden Verlagen ihre Daseinsberechtigung erwirken und Agenten, bei denen es sich ähnlich verhält, braucht man über den Wert überhaupt nicht reden: Niemand braucht einen Onlinekurs „Roman schreiben“. Entweder, man ist in der Lage so ein Ding selbsttätig zu Ende zu bringen, oder man ist es nicht. Alles weitere ist viel zu viel Geschmackssache; natürlich sollte eine Geschichte irgendwie Logik und Sinn haben, aber kein Kurs wird Logik und Sinn in etwas bringen, wo am Anfang nicht schon ziemlich viel davon vorhanden war.
Im besten Fall kann so ein Kurs, wenn er von einer kompetenten Person persönlich und mit Engagement begleitet wird, zum Ausmerzen einiger logischer Fehler und Klärungen allzu sehr ins Kraut geschossener Handlungsstränge. Mit anderen Worten, nichts, was ein gutes Lektorat oder die wohlmeinende Lektüre von Bekannten, insbesondere, wenn diese selbst schreiben, nicht auch hinbekommen werden. Eigentlich sind diese Kurse Aufbewahrungsanstalten für ambitionierte Nichtskönner. Menschen mit Talent, die sich dorthin verirren, werden fast immer enttäuscht zurückbleiben.
Schreibkurse, „Werkstätten“ und anderes Self-help-Gedöns
A propos ambitionierte Nichtskönner. Da wären da ja auch noch die ganzen Finde-dich-selbst-durch-Schreiben-Kurse und -„Werkstätten“. In einem Fall erinnere ich mich, dass mir eine Leiterin eines solchen Workshops erklärte, die Teilnehmer hätten Collagen aus aus Zeitungen gerissenen Wörtern angefertigt, so dass „Gedichte“ (was man eben darunter versteht) entstanden seien. Die Ergebnisse waren genauso, wie man es sich denken kann.
Das Problem ist, dass seit im 20. Jahrhundert klassische Kunstregeln außer Kraft gesetzt wurden – egal, in welcher Domäne der Kunst wir uns bewegen – nun alle meinen, wenn sie auch einen Strich auf Papier tun können oder drei Wörter willkürlich aneinanderreihen, seien sie große Künstler und Poeten. Naja, das ist nicht der Fall, und von daher rate ich jedem mit mehr als drei Gehirnzellen, einen großen Bogen um solche Schreibkurse bzw. Werkstätten und Kurse zum „Kreativen Schreiben“ zu machen. Insbesondere gilt das von Kreatives-Schreiben-Kurs an der VHS. Oder eigentlich jedem Kurs an der VHS. Dort trifft sich seit jeher die Crème de la Crème der eingebildeten Intelligenz und pädagogischen Empathie.
Zu echten therapeutischen Zwecken eignet sich Kreatives Schreiben bzw. Übungen darin sicherlich gut, und dafür sollte es auch gerne eingesetzt werden. Da denken die Teilnehmer hinterher aber auch in aller Regel nicht, sie seien große Künstler, denn der Zweck war ja von vornherein ein anderer.
Der Zweck großer Literaturinstitute
Etwas anderes sind die „echten“ Literaturinstitute, wie es sie zum Beispiel in Leipzig gibt. Auch da darf man sich keiner Illusion hingeben. Dort wird man nicht angenommen, weil man besonders gut ist, sondern weil man ein gewisses Grundtalent mitbringt, das auf den Markt hin formbar ist – und zwar in aller Regel auf einen sehr spezifischen und ziemlich bourgeoisen Markt hin. Da die Institute aber die entsprechenden Verbindungen zum Markt und zu den passenden Verlagen haben, ist das sicherlich sinnvoll, wenn man diese Gruppe passt oder passen will. Aber man darf nicht glauben, dass das Ergebnis besonders kreative und individuelle Autoren sind – auch wenn sie sich dafür halten.
Wenn man verschiedene Autoren aus demselben Literaturinstitut (jedenfalls kann ich das für Leipzig sagen) vergleichend liest, sind der Ergebnisse einander ziemlich ähnlich. Das ist aber auch nicht überraschend, sondern eben das Produkt von „Schulen“. Einen tut die Absolventen solcher Institutionen meist ihre Überheblichkeit, und nicht selten die Idee, dass je abgefahrener und unverständlicher das Ergebnis ist, desto hochwertiger ist es. Natürlich gilt das nicht für alle, aber die Tendenz ist da. Mit anderen Worten: Das Ganze hat seinen Wert, wenn man seine Bücher verkaufen will und formbar ist. Ansonsten gilt auch hier, dass man besser einen Bogen drum macht. (Ohnehin wird man aber dann nicht angenommen, wenn man diese Grundbedingungen nicht erfüllt.)
Kann man literarisches Schreiben lernen?
Meine Antwort: ja und nein. Es ist wie beim Schauspiel und beim Malen auch. Ein gewisses Grundtalent muss man schon mitbringen, den Rest muss man trainieren. Nur ist die Frage, wie man es eben trainieren sollte oder muss. Bekanntermaßen hat Goethe nie ein Literaturinstitut besucht oder einen Abschluss in einem Onlinekurs „Schreib dein Buch!“ absolviert. Dennoch hat sich sein Schreiben sicherlich weiterentwickelt.
Was hat er dafür getan? Er hat viel gelesen. Das ist schon einmal einer der allerwichtigsten Faktoren. Dann hat er geschrieben. Wer einfach schreibt, merkt auch schnell, was nicht so richtig funktioniert, sodass Schreiben selbst schon als Korrektiv fürs Schreiben wirkt. Und dann kommt natürlich der Austausch mit anderen Schreiberlingen – und auch anderen Menschen! – hinzu. Meines Erachtens funktioniert das alles auch heute noch besser als jeder Kurs, jeder Agent und jedes Institut. Jedenfalls, wenn es darum geht, seine authentische Autorenstimme zu entwickeln und nicht primär darum, etwas zu verkaufen.
Publizieren als Selfpublisher – ja oder nein?
Ich publiziere generell alles selbst – entweder auf einer meiner Homepages oder ich nutze einen Selfpublisher-Dienst. Natürlich erspart einem die Arbeit mit einem Verlag viel Mühe, was Gestaltung und insbesondere Vermarktung angeht. Dafür macht es mehr Mühe, einen Verlag zu finden. Und in der Regel braucht man dafür dann auch noch wieder einen Agenten. Hat man den erst einmal gefunden, ja, hat man natürlich eine größere Chance am Markt auch tatsächlich Fuß zu fassen, insbesondere, wenn Marketing jetzt nicht zu den eigenen Steckenpferdchen gehört. Die klaren Nachteile: Verlag und Agent wollen jeweils Geld. Die Erträge, die einem pro Buch übrigbleiben, sind eigentlich dann lächerlich. Wenn man also nicht gerade sofort einen Bestseller hinlegt, kommt da in finanzieller Hinsicht nicht viel bei rum. Andererseits: Wer als Selfpublisher publiziert, muss natürlich alle Investments in PR und Marketing selbst tragen. Im Falle der Publikation bei einem Verlag trägt der Verlag das Risiko.
Das Recht am eigenen Inhalt
Eine andere Sache ist, sagen wir es vorsichtig, das Mitspracherecht. Der Verlag, oder gegebenenfalls der Agent, bevor überhaupt ein Verlag ins Spiel kommt, haben ein begründetes Interesse daran, dass sich das Buch natürlich auch verkauft. Darum werden erstens nur Werke ausgesucht, die ein hohes Potential haben, am Markt „zu funktionieren“ – und Debütautoren werden gerne auch so „geformt“, dass sie und ihre Bücher eben besonders gut verkaufbar sind. Das ist, wie schon gesagt, aus Sicht des Verlags und des Agenten nachvollziehbar. Und manch ein Autor hat vielleicht auch gar nichts dagegen. Ich persönlich stand für solche Formungsprozesse nie bereit, und besonders massentauglich ist das, was ich schreibe, auch nicht.
Selfpublisher vs. Verlage: die Qualitätsfrage
Naja, sagen nun viele, da ist ja aber dann auch die Qualität viel besser! Das halte ich für ein Gerücht. Was wahr ist: Im Bereich Selfpublishing gibt es in dem Sinne keine Qualitätskontrolle, als wirklich jeder publizieren kann, was er will. Was auch wahr ist: Die so genannte „Qualitätskontrolle“ der Verlage ist weniger eine Qualitäts- als eine Marktkontrolle. Im Zweifel wird der Zweifel auch den größten Mist publizieren, wenn er überzeugt ist, dass das Publikum es kauft.
In dem Raum dazwischen ist es natürlich zutreffenden, dass manche Möchtegern-Autoren, bei denen wirklich so gar kein Talent erkennbar ist, aussortiert werden. Aber eben auch ganz talentierte Autoren, die aus dem einen oder anderen Grund gerade nicht in irgendein Verlags- und Agentenprofil passten. Ich persönlich habe zwar auch viele Menschen getroffen, die glaubten, zum Schreiben berufen zu sein, die aber das Äquivalent der schmerzvollsten DSDS-Castings im Bereich „Schreiben“ waren. Auf der anderen Seite kenne ich persönlich einige Selfpublisher, die wirklich gute Bücher schreiben.
Die Zeiten, wo Selfpublishing etwas für die Idioten war, die sonst zu Recht keinen Fuß auf den Boden gekriegt hätten, sind wirklich lange, lange vorbei. Es gibt eine Vielzahl wirklich erfolgreicher Selfpublisher, und das ist so ziemlich jedem Bereich, egal, ob Literatur oder Sachbuch. Ich persönlich habe mit dem Selfpublishing im Bereich Sachbuch angefangen, und zwar ganz bewusst unter einem Pseudonym. Erst aktuell bereite ich die ersten literarischen Texte für die Publikation vor, die dann auch unter meinem richtigen Namen erscheinen sollen.
Selfpublishing und Bezahlverlage
Dank neuer Dienste wie Amazon KDP, BoD und Tredition ist mittlerweile gar nicht mehr auf den ersten Blick ersichtlich, ob es sich um ein Selfpublisher-Buch handelt oder nicht. Das ist ein großer Vorteil, da auch aufseiten manch eines Lesers – obschon nur in einer gewissen Alterkohorte und einer gewissen Schicht, vermutlich – noch immer die oben genannten Vorurteile bestehen.
Im Eigenverlag verlegen
Die Optionen, die sich beim Selfpublishing bieten, sind groß. Natürlich kann man auch ganz eigenständig einen Verlag oder einen Eigenverlag gründen, die Bücher produzieren (lassen) und sich anschließend um den Vertrieb und die Vermarktung kümmern. Das hat den Nachteil, dass man dann recht hohe Investitionskosten hat und auf einem Riesenhaufen physischer Bücher sitzt, die erstmal an den Mann gebracht werden wollen. Von allen Optionen erschien mir das immer die aufwändigste – auch eben in finanzieller Hinsicht.
Als Print-on-Demand publizieren
Die kostenärmste Variante, sein Buch als physisches Werk unter die Leute zu bringen, ist zweifellos Print-on-Demand. Die Buchqualität ist in den letzten Jahren auch immer besser geworden. Hier muss man zwar immer noch die fertige Druckvorlage liefern, man muss sich aber nicht mehr um den Vertrieb seines Buchs kümmern. Die (überschaubare) Logistik übernimmt der Dienstleister, bei dem man sein Buch verlegt. Konkret bedeutet das: Am Autor bleiben die Kosten für Design, Buchsatz, Korrektorat und Lektorat hängen. Danach fällt eigentlich nicht mehr viel an.
Wer direkt bei KDP publiziert, hat eine recht hohe Marge. Dafür hat man weniger Gestaltungsmöglichkeiten, was Ausstattung des Buches und Papier angeht. Da sind Anbieter wie Tredition, BoD und andere definitiv besser. Gerade, wenn man einen Bildband publizieren will etwa, sollte man sich dann schon überlegen, ob man nicht lieber auf solche Mittelsmänner zurückgreift.
Sie haben noch einen anderen Vorteil: Wer das Marketing nicht selbst machen will, kann dort für gewisse Zusatzkosten entsprechende Pakete buchen. Dasselbe gilt für Buchsatz, Korrektorat usw. Das kostet aber natürlich zusätzlich, und wie die Qualität des Marketings ist … nun ja, man darf nicht erwarten, dass sich jemand reinhängt und das eigene Werk mit hohem Energieaufwand anpreist. Hier wird dann sehr wahrscheinlich überall mehr nach dem Gießkannenprinzip verfahren. Daher rate ich von diesen Zusatzpaketen eigentlich eher ab.
Ein weiterer Wermutstropfen: Die Marge bei BoD, Tredition und Co. ist deutlich niedriger als z.B. bei KDP. Zudem ist die Einflussnahme auf das Marketing geringer, da man die Suchmaschinenoptimierung auf den verschiedenen Plattformen nicht beeinflussen kann. Natürlich kann man aber weiter über z.B. eine eigene Website für sein Buch werben.
Übrigens bedeutet eine Publikation bei KDP in der Regel nicht, dass man nicht anderswo auch publizieren darf. Insofern ist eine gewisse Abhängigkeit von Amazon in dem Fall zwar da, aber sie ist nicht zwingend. Wer will, publiziert eben auch noch an anderer Stelle und diversifiziert so.
Der Bezahlverlag – das angebliche Pfui-pfui-Modell
Wer sich mal in verschiedenen Foren zum Thema Publishing umtut, stellt schnell fest, dass Bezahlverlage nicht gerade einen guten Ruf genießen. Ich halte das weitgehend für ungerechtfertigt. Das Argument, das man meist hört, ist: „Ein anständiger Verlag würde niemals von jemandem Geld nehmen …“ Was das wirklich heißen soll, ist: Die so genannten „anständigen Verlage“ publizieren die einzig wahre Qualität. Das ist bis zu einem gewissen Grad, wie schon oben angesprochen, ein Mythos.
Verlage sind gewinnorientierte Unternehmen. Mag sein, dass der eine oder andere unrentable Sparten aus Idealismus querfinanziert mit marktgängigen Bestsellern. Aber im Prinzip ist und bleibt ein klassischer Verlag ein gewinnorientierter Betrieb. Sie produzieren nicht Werke, die Qualität garantieren. Sie nutzen ihre Markenidentität, um dem Publikum zu kommunizieren, was Qualität ist. Dabei operieren sie natürlich in einem gewissen Fenster dessen, was für das spezifische Publikum „goutabel“ ist. Dieser Prozess ist aber kein Garant für eine irgendwie objektive Qualität, es ist ein spezifisches Zusammenspiel aus Markenidentität und Konsumervorlieben. Gatekeeping ist ein tolles Instrument, wenn man es nutzen kann – aber es garantiert keinesfalls irgendeine Art von Qualität.
Bezahlverlag – ein anderes Geschäftsmodell
Ein Bezahlverlag hat diese Reputation nicht und operiert anders am Markt. Gatekeeping gibt es hier nicht. Warum das nicht direkt mit irgendwie intersubjektiv gültigen Qualitätskriterien zu tun hat, habe ich gerade schon erklärt. Das Gatekeeping und das gezielte Ausspielen von dem Publikum angepassten Inhalten sorgt dafür, dass ein klassischer Verlag bereit ist, das Risiko zu tragen und kein Geld vom Autoren zu nehmen. Das hat nichts mit der moralischen Adäquatheit des klassischen Verlags zu tun oder mit der Qualität seiner Produkte, sondern mit seinem Geschäftsmodell und seiner etablierten Position am Markt.
Die Idee des Bezahlverlags ist eine andere: Er bietet die Dienstleistung des Drucks und Vertriebs an. Dafür verlangt er eine Vergütung. Daran ist nichts Anrüchiges.
Wie sinnvoll ist die Publikation in einem Bezahlverlag?
Eine andere Frage ist, ob ein Bezahlverlag für die Publikation des eigenen Werks immer so sinnvoll ist. Aus meiner Sicht steht es ähnlich wie mit Anbietern wie Tredition oder BoD, wobei sich Bezahlverlage primär für Menschen eignen, die (a) keine eigene Verlagsmarke aufbauen und (b) vornehmlich Print-Bücher produzieren wollen. Generell würde ich, gleiche Qualität in der Ausfertigung vorausgesetzt, immer Print-on-Demand-Verfahren den Vorzug geben. Aber letztlich bleibt sich das vom finanziellen Aufwand her meist fast gleich.